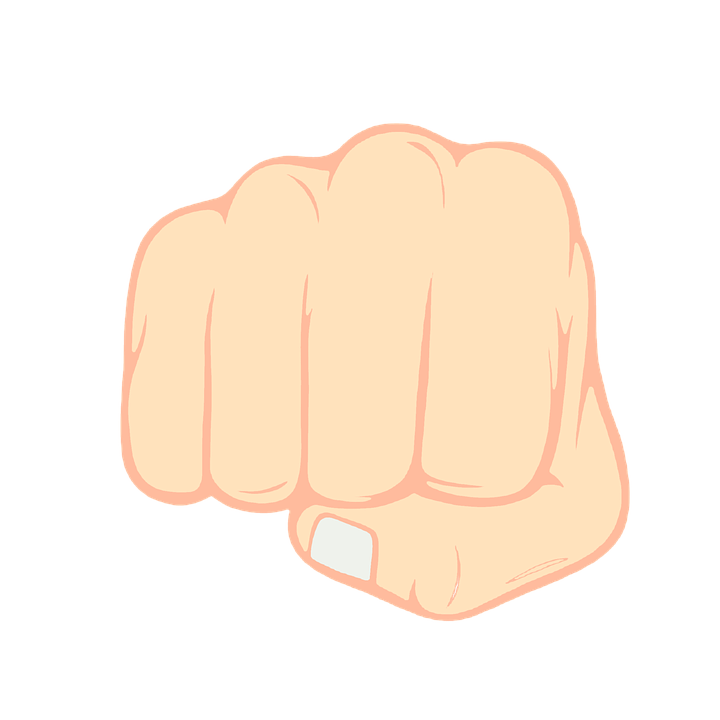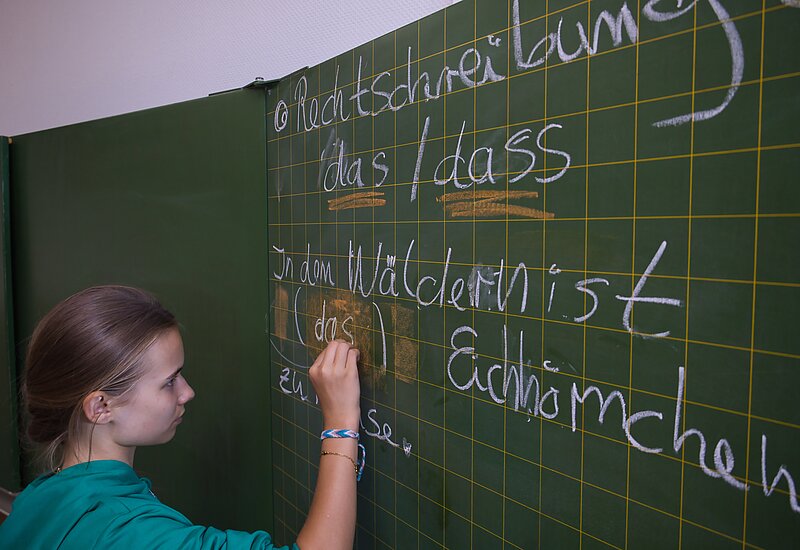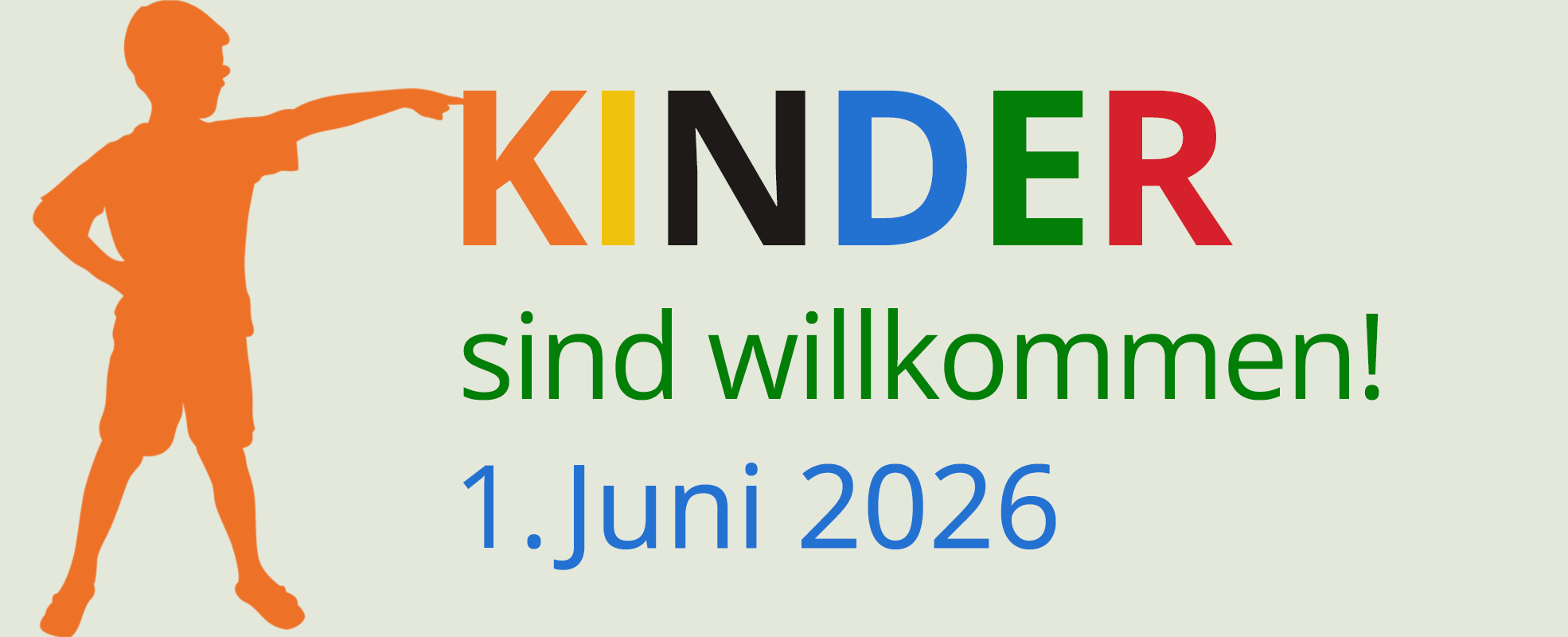Der im Jahr 2000 gegründete Fachbereich Informatik und Medien der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. In einem Interview blicken der Dekan des Fachbereichs, Prof. Dr.-Ing. Martin Schafföner, sowie die Professoren Prof. Dr. Jessica Broscheit und Prof. Dr.-Ing. Thomas Preuß auf die Entwicklung des Fachbereichs.
Sie alle sind unterschiedliche lang am Fachbereich Informatik und Medien tätig: Was ist Ihre erste Erinnerung bzw. Ihr erster Berührungspunkt mit dem Fachbereich an der THB?
Thomas Preuß (TP): Mein erster Berührungspunkt mit dem Fachbereich war im Jahr 2001. Ich war damals 32 Jahre alt, der jüngste berufene Professor an der Hochschule und der erste, der offiziell für den neu gegründeten Fachbereich Informatik und Medien berufen wurde. Der Fachbereich selbst war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zehn Monate alt.
Martin Schafföner (MS): Ich war schon seit vielen Jahren Abonnent der ZEIT, in der regelmäßig die zu besetzenden Professuren veröffentlicht werden. Ich habe in diesen Teil eigentlich nie reingeschaut, war dann aber 2013 doch ein einziges Mal neugierig. Dabei bin ich über die Ausschreibung aus der Heimat gestolpert und habe mich beworben. Bereits einige Tage nach Bewerbungsschluss kam die Einladung zum „Vorsingen“ – der Rest ist Geschichte.
Jessica Broscheit (JB): Meinen ersten Berührungspunkt mit dem Fachbereich hatte ich im Jahr 2016, als ich an der HAW Hamburg war und Ingo Boersch von der THB einen spannenden Vortrag über KI hielt. Später erfuhr ich noch von den legendären und zu tiefst emotionalen Roboter-Fußballspielen, die zwischen der HAW Hamburg und THB ausgetragen wurden.
Prof. Preuß, Sie waren fast seit Beginn des Fachbereichs dabei – wie würden Sie die Atmosphäre der Anfangszeit beschreiben?
TP: Es war die Zeit des Internet-Booms und der sogenannten „New Economy“. Informatikerinnen und Informatiker waren extrem gefragt. Viele Studierende sind nach ihrem Pflichtpraktikum im fünften Semester gleich in den Unternehmen geblieben, oft ohne das Studium abzuschließen.
Was waren damals die relevanten Themen für den Fachbereich?
TP: Damals stand die Vernetzung im Mittelpunkt. 2001 haben wir mit „Network Computing“ eine neue Studienrichtung eingeführt, die später zu „Cloud & Mobile Computing“ weiterentwickelt wurde. Das war der Versuch, früh auf die entstehenden Anforderungen der vernetzten Welt zu reagieren. Ein großes Thema war auch der Online-Studiengang Medieninformatik, kurz OSMI, der im selben Jahr startete. Das war eines der ersten Online-Bachelorangebote in Deutschland überhaupt. Heute, mehr als zwanzig Jahre später, studiert etwa die Hälfte unserer Studierenden online. Und praktisch alle Lehrenden unterrichten sowohl online als auch in Präsenz.
Prof. Schafföner, als Dekan erleben Sie heute den Fachbereich in seiner ganzen Breite. Wenn Sie zurückblicken – was hat sich im Selbstverständnis des Fachbereichs am stärksten verändert?
MS: Der Fachbereich tritt heute noch geschlossener auf als vor zehn Jahren. Damals wurde noch streng zwischen Informatik, Digitalen Medien und Medieninformatik unterschieden. Heute können die Medienkolleginnen und -kollegen auch programmieren und die Informatikerinnen und Informatiker sind neugierig darauf, interaktive Systeme aller Art zu konstruieren. Gemeinsam wird viel getüftelt und gelacht.
Welche Meilensteine waren aus Ihrer Sicht entscheidend für die Entwicklung des Fachbereichs?
MS: Es ging schon vor der Gründung des Fachbereichs mit der Einführung attraktiver und zukunftsweisender Schwerpunkte „Intelligente Systeme“ und „Digitale Medien“ im damaligen Diplomstudiengang Informatik los. Das war 1996. Im Jahr 1998 kam dann der Beginn der bundesweiten Kooperation im Bundesleitprojekt Virtuelle Fachhochschule (VFH), aus der 2001 die Online-Studiengänge Medieninformatik (Bachelor und Master) und 2020 der Online-Bachelorstudiengang IT-Sicherheit hervorgingen. Wichtig war und ist auch die Kooperation mit dem Städtischen Klinikum Brandenburg, heute Universitätsklinikum Brandenburg, ohne dessen umfangreiche Unterstützung die Einführung des Studiengangs Medizininformatik nicht möglich gewesen wäre.
Prof. Broscheit, Sie sind seit 2024 Professorin an der THB und gehören damit zu den neueren Mitgliedern im Kollegium. Wie haben Sie den Fachbereich kennengelernt? Und was hat Sie gereizt, hier zu lehren und zu forschen?
JB: Am Fachbereich hat mich besonders die enge Verbindung von angewandter Informatik und Medien angesprochen. Diese Verbindung ist an Hochschulen nicht selbstverständlich, bietet aber eine ideale Voraussetzung, um interaktive Systeme im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion zu erforschen und zu lehren. Besonders durch die praxisorientieren Labore haben Studierende die Möglichkeit, eigene innovative Projekte umzusetzen. Sie erlernen nicht nur gestalterische und technologische Fähigkeiten, sondern auch wichtige Kompetenzen wie Projektplanung, interdisziplinäres Denken und lösungsorientiertes Arbeiten.
Die Informatik- und Medienwelt hat sich in den vergangenen 25 Jahren rasant weiterentwickelt – was blieb über die Jahre gleich und was hat sich am meisten verändert?
TP: Informatik war immer eine Disziplin, in der man Dinge verstehen und abstrahieren, aber vor allem gestalten wollte. Was sich verändert hat, ist die Geschwindigkeit. Entwicklungen, für die früher Jahre vergingen, passieren heute in Monaten. Besonders deutlich wurde das während der Corona-Zeit. Da hatten wir dank unseres Online-Studiengangs zwar Erfahrung mit digitaler Lehre, aber keine eigene technische Infrastruktur. Die Nachricht, dass das Sommersemester nicht in Präsenz starten würde, kam am Freitag vor Semesterbeginn. Ich habe mir dann verschiedene Videokonferenzsysteme angeschaut, aber keines erfüllte unsere Anforderungen. Dann habe ich BigBlueButton getestet, in der Cloud installiert und noch am selben Tag eine erste Konferenz mit unserem Dekan gestartet. Nach zwei Wochen nutzte die gesamte Hochschule das System.
Wie gelingt es, in einem solch dynamischen Themenfeld die Lehre stets aktuell zu halten und an die Bedürfnisse der Zeit anzupassen?
MS: Die Aktualisierung der Lehre hat mehrere Facetten. Da ist natürlich der Inhalt, die Fachlichkeit – das ist originäres Thema jeder Professorin und jedes Professors. Durch Interaktion mit Unternehmen, insbesondere durch Transferprojekte, werden die Bedürfnisse der gewerblichen Wirtschaft aufgenommen und können in die Gestaltung der Lehre einfließen. Schließlich ist auch die Didaktik beständigem Wandel unterworfen. Hierzu nutzen wir Weiterbildungsangebote des landesweiten Netzwerks Studienqualität Brandenburg oder den kollegialen Austausch, besonders im VFH-Hochschulverbund.
Wie hat sich die Zusammensetzung der Studierenden im Laufe der Jahre verändert – in Bezug auf Interessen, Vielfalt und Erwartungen?
MS: Es ist weiterhin so, dass in den Präsenzstudiengängen überwiegend Studierende frisch von der Schule studieren, während in den Online-Studiengängen überwiegend Studierende ab Mitte 20 studieren – im Beruf, mit Familie. Hinzugekommen sind die dual Studierenden, die wegen langfristiger Bewerbungen und Auswahlverfahren in den Unternehmen eine bessere Vorstellung davon haben, was sie erwartet und was sie erwarten. Bei den ausländischen Studierenden hat sich die Nachfrage verbreitert. Lag vor zehn Jahren ihr Fokus auf der Medizininformatik, hat sich das Interesse auch auf die klassische Informatik ausgedehnt.
Welche technischen Kompetenzen müssen Studierende heute mitbringen, die früher weniger im Fokus standen?
TP: Wir haben unsere Studierenden nie als reine Programmierer ausgebildet. Uns war immer wichtig, dass sie die Modelle und Konzepte hinter den Technologien verstehen. Wer nur Werkzeuge bedient, verliert schnell den Überblick, wenn sich die Werkzeuge ändern. Heute geht es noch stärker darum, Prinzipien zu verstehen, zu abstrahieren und kritisch zu denken. In der Informatik kehren bestimmte Konzepte in neuen Formen immer wieder – wer das erkennt, kann sich in jeder technischen Umgebung zurechtfinden. Unsere Studierenden müssen heute zunehmend in der Lage sein, Anforderungen zu erkennen, aufzunehmen und in KI-basierte Lösungen zu überführen. Diese Fähigkeit, Anforderungen in technische Konzepte und intelligente Systeme zu übersetzen, wird immer zentraler.
Prof. Broscheit, Sie sind Professorin für Digitale Medien, insbesondere Mediengestaltung – Medien und Gestaltung waren anfangs oft ergänzend gedacht. Wie sehen Sie die Verknüpfung von Technologie und Gestaltung?
JB: Ich kann Technologie und Gestaltung nicht getrennt voneinander betrachten. Für mich stehen die beiden Bereiche in einem kontinuierlichen Dialog. Jede neue Technologie bringt nicht nur neue Werkzeuge hervor, sondern auch neue Ausdrucksformen und Medien. Die technologische Kompetenz ist für mich ein wesentlicher Bestandteil des kreativen Gestaltungsprozesses. Nur wer die technischen Möglichkeiten und Grenzen kennt, kann innovative Konzepte entwickeln und diese umsetzen.
Wie sehen Sie die Zukunft digitaler, interaktiver Mediengestaltung? Welche neuen Berufsbilder oder Studieninhalte entstehen gerade?
JB: KI-Werkzeuge unterstützen uns bei vielen gestalterischen und technischen Aufgaben. Dennoch bleiben die Produktentwicklung, Konzeptarbeit und Kundenberatung in menschlicher Hand. Dadurch gewinnt die Schnittstelle zwischen Auftraggebern, Konsumenten und interdisziplinären Entwicklungsteams zunehmend an Bedeutung. Diese Schnittstelle kann beispielsweise durch einen „Creative Technologist“ besetzt werden. Entscheidend ist aber nicht die Berufsbezeichnung, sondern dass wir unsere Neugier bewahren und uns an eine dynamische Arbeitsumgebung anpassen können.
Der Fachbereich Informatik und Medien umfasst heute fünf Bachelor- und drei Masterstudiengänge, die eine Bandbreite von klassischer Informatik über Medizininformatik und Digitalen Medien bis zu IT-Sicherheit abdecken. Wie gelingt es, diese Vielfalt produktiv zu verbinden?
MS: Jedes Thema der Kerninformatik sucht Anwendungsfelder und jedes unserer Anwendungsfelder braucht die Kerninformatik. Und auch die Anwendungsfelder untereinander haben vielfältige Berührungspunkte. Krankenhaus- oder Praxisinformationssysteme müssen sicher sein, dabei aber auch intuitiv und ermüdungsarm zu bedienen sein. Künstliche Intelligenz verbessert medizinische Diagnosen, ist aber selbst Ziel neuartiger Angriffe. Keines der Themen kann von einer Person allein überblickt werden, so dass die Kolleginnen und Kollegen gern in den Austausch untereinander gehen. Das betrifft übrigens nicht nur die Kolleginnen und Kollegen im eigenen Fachbereich, sondern natürlich auch die Nachbarn im eigenen Haus oder bei unseren Partnerhochschulen.
Welche aktuellen Forschungsschwerpunkte zeigen, wofür der Fachbereich heute steht?
MS: Der Fachbereich bearbeitet in seinen Forschungsschwerpunkten Kernthemen der Informatik wie Cloud & Mobile Computing, Künstliche Intelligenz und Security & Forensics sowie die Anwendungsgebiete „Interaktive Medien“ und „Medizininformatik“. Keines dieser Gebiete arbeitet dabei isoliert: Medizininformatik-Anwendungen beispielsweise nutzen KI-Technologien, die wiederum als Cloud-Dienste betrieben werden. Aktuelle Projekte umfassen Cloud-Anwendungen für die Energiewirtschaft mit KI-Technologien, mobile Anwendungen zur Verbesserung von Therapie-Compliance unter besonderer Berücksichtigung von Datenschutzanforderungen oder die Digitalisierung von Kulturgütern als internationales Projekt. Die Vielfalt der Projekte unterstreicht die besondere Leistungsfähigkeit des Fachbereichs durch gemeinsame, interdisziplinäre Arbeit.
Die Medienwelt wird durch KI und generative Tools umgekrempelt. Wie verändern solche Entwicklungen die Lehre und Gestaltungspraxis?
TP: Künstliche Intelligenz ist ohne Zweifel ein Game-Changer. Sie verändert die Art, wie wir lehren, wie wir programmieren und auch, wie wir prüfen. Wir müssen heute Aufgaben und Prüfungsformate ganz anders gestalten als früher, weil Studierende Aufgaben oft mithilfe von KI lösen. Die Herausforderung liegt darin, Aufgaben so zu formulieren, dass sie nicht nur reproduzierbares Wissen abfragen, sondern dazu anregen, sich kritisch mit der KI auseinanderzusetzen. Noch besser ist es, wenn Studierende lernen, die Stärken und Schwächen der KI selbst zu hinterfragen und zu bewerten.
JB: KI-Werkzeuge haben den Gestaltungsprozess demokratisiert und seine Effizienz deutlich gesteigert. Was früher ein aufwendiger Ablauf war, der von Expertinnen und Experten ausgeführt wurde, kann heute innerhalb kürzester Zeit von einer KI erledigt werden. Früher wurde beispielsweise ein Bild mit einer analogen Kamera aufgenommen, entwickelt, eingescannt und sorgfältig nachbearbeitet. Jedes Staubkorn, das sich während des Scans auf dem Bild verewigt hatte, musste entfernt werden. Das war eine reine Fleißarbeit. Heute können wir ein „gewünschtes“ Bild von einer KI generieren lassen, ohne dass eine Kamera zum Einsatz kommt. Auch wenn die bildgenerierenden KIs nicht immer die erhofften Ergebnisse liefern, ist diese Entwicklung enorm.
Welche Herausforderungen bringt diese Entwicklung mit sich?
JB: Ein Nachteil ist, dass KI-generierte Designs oft generisch und austauschbar wirken. Oft fehlt es ihnen an konzeptioneller Tiefe und Originalität. Studierende müssen deshalb lernen, mit KI-Werkzeugen kreativ und verantwortungsvoll umzugehen sowie die Lösungsansätze der KI kritisch zu reflektieren und zu bewerten. Im Gegensatz zur reinen Wissenswiedergabe sind das anspruchsvolle Lernziele, die innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden müssen.
MS: Gesellschaftliche Vorteile großer KI-Systeme müssen gegen individuelle Schutzbedürfnisse von Personen oder Organisationen abgewogen werden. Die Diskussion muss ernsthaft, ehrlich und ergebnisoffen geführt werden. Und auch technologische Lösungen zur Vereinbarkeit von Datenschutz von Individuen und Datenbedarf für KI-Systeme müssen weiterentwickelt werden.
Was denken Sie, Prof. Schafföner, wie wird sich der Fachbereich in den nächsten zehn Jahren durch KI verändern?
MS: Die Informatik stellt nicht nur KI-Technologien für andere Wissenschafts- und Wirtschaftsgebiete bereit, sie verändert sich auch selbst durch die KI. Beispielsweise können große Sprachmodelle Programmcode aus natürlichsprachlichen Anweisungen erzeugen. Die richtigen Anweisungen aus den Bedürfnissen der Anwender zu erzeugen, die Bewertung des erzeugten Programmcodes, die dauerhafte Qualitätssicherung dieser neuartig erzeugten Anwendungen und deren Betrieb werden sich von bisherigen Ansätzen unterscheiden. Diese Durchdringung und Veränderung in allen Bereichen der Curricula und der Forschungsprojekte zu erzeugen, wird eine zentrale Herausforderung des nächsten Jahrzehnts sein. Dies drückt sich auch in einem erhöhten Stellenbedarf mit KI-Bezug aus, um auch künftige Entwicklungen aktiv mitgestalten zu können.
Wenn wir uns in weiteren 25 Jahren wieder hier treffen würden – was wünschen Sie sich, dass man dann über den Fachbereich Informatik und Medien sagt?
MS: Ich wünsche mir, dass man über den Fachbereich sagt, tatkräftige Neugier sei sein Kern.
TP: Ich wünsche mir, dass man sagt: Der Fachbereich hat den Wandel nie verschlafen, sondern ihn gestaltet. Und dass er auch nach 50 Jahren noch den Mut hat, Neues auszuprobieren. Wenn wir das schaffen, dann bleibt der Fachbereich lebendig, egal wie sich die Technologien verändern.
JB: Ich schließe mich dem an und füge noch ein Ausrufezeichen hinzu.
Quelle: Technische Hochschule Brandenburg
University of Applied Sciences